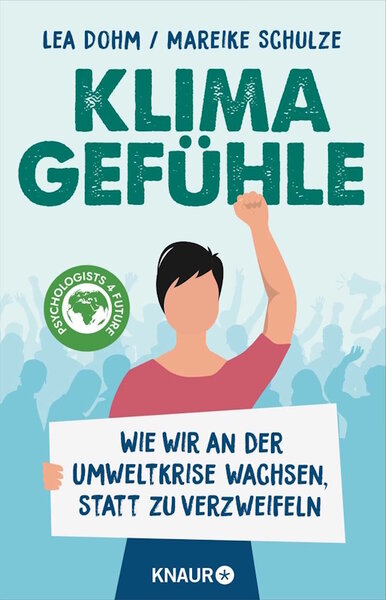Kein Grund zu verzweifeln – Sie können etwas tun
Die Klimakrise erscheint oft übermächtig, doch das ist sie nicht: Ein Gastbeitrag von Lea Dohm
(3. November 2025) Die Notwendigkeit einer ambitionierten Energiewende ist wissenschaftlich wie politisch unbestritten. Die Nutzung fossiler Energieträger heizt die Klimakrise an und führt zu geopolitischen Abhängigkeiten sowie zu ökologischen, gesundheitlichen und mittelfristig auch wirtschaftlichen Schäden. Für eine Gesellschaft, die sich unabhängig, nachhaltig und krisenresilient aufstellen möchte, führt an einer tiefgreifenden Transformation unserer Energieversorgung daher kein Weg vorbei.

Die Psychologin Lea Dohm ist Beraterin der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ihr Thema sind psychologische Aspekte einer sozial-ökologischen Transformation.
»Die Energiewende erfordert Veränderungen im Verhalten – und trifft auf eine veränderungsmüde Bevölkerung«
Doch die Energiewende ist nicht nur eine technische und politische Aufgabe, sie ist auch eine psychologische Herausforderung. Sie erfordert Veränderungen im Verhalten, im Konsum und in den Gewohnheiten von Millionen Menschen – und trifft dabei auf eine veränderungsmüde Bevölkerung, die sich nach Stabilität und Sicherheit sehnt. Vielen stellt sich daher die Frage: Wie können wir wirksam zu diesen großen Veränderungen beitragen, ohne uns und andere zu überfordern oder schlechtestenfalls in Resignation zu verfallen?
Um dies zu beantworten, sollte man sich klar machen, dass wir Menschen bei komplexen Problemen dazu neigen, unseren Einfluss zu unterschätzen. In der Forschung ist dies vielfältig beschrieben: Je mehr Menschen beteiligt sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne aktiv werden. Das ist der sogenannte bystander effect. Mit Blick auf die internationale Dimension der Klimakrise haben wir es gar mit einem global bystander effect zu tun. Denn es sind so viele Staaten und Institutionen Teil des Problems, dass es nur verständlich erscheinen mag, sich hoffnungslos zurückziehen zu wollen.
Doch die Möglichkeiten des wirksamen eigenen Handelns sind bekannt und vielfältig. Ein Startpunkt ist die Kommunikation: Wenn schwer verständliche Schlagworte die öffentliche Debatte dominieren (»Dekarbonisierung«, (»Netzausbau«, »Sektorkopplung« etc.), fällt es vielen schwer, eigene Bezugspunkte auszumachen. Oft vermeiden sie solche Themen dann oder wenden sich vermeintlich einfachen Lösungen zu (etwa der Rückkehr zur Atomkraft). Wem die Energiewende am Herzen liegt, sollte ihre Aspekte daher in allgemein verständliche und verdauliche Häppchen teilen – und fortan mehr darüber sprechen.
Sich Herausforderungen zuzuwenden, erfordert immer eine innere Bereitschaft. Vielleicht haben auch Sie schon versucht, einer Person zuzuhören, die Ihnen von etwas berichtete, wozu sie (scheinbar) wenig Alltagsbezug haben? Das kann anstrengend sein. Leichter wird es, wenn wir die Relevanz für unseren Alltag erkennen. Das Aufzeigen alltagsnaher Bezugspunkte ist auch in Fragen der Energiewende eine wichtige Voraussetzung für ein gelingendes Gespräch.
Mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist leicht. Sinnvoller ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sympathischer ist es allemal
Wir leben in gesellschaftlichen Strukturen, die wirklich nachhaltiges Handeln eher verunmöglichen als begünstigen. Aktuell ist noch praktisch niemand beim Thema Klima und Emissionen frei von »Schuld«. Wir können daher keine Perfektion voneinander erwarten. Auch wer in den Urlaub fliegt, eine Ölheizung betreibt oder Fleisch konsumiert, ist herzlich eingeladen, sich an anderer Stelle für Klimaschutz, Artenvielfalt und eine ambitionierte Energiewende einzubringen.
Einen psychologischen Blick auf die Energiewende wirft Lea Dohm auch in ihrem gemeinsam mit Mareike Schulze verfassten Buch »Klimagefühle« von 2022.
Wir zeigen oft mit dem Finger auf andere zeigen, auf China, »die Politik«, »die Wirtschaft« oder die schon wieder kreuzfahrtreisende Nachbarin. Doch statt sich im Ärger zu verlieren und damit der zugrunde liegenden Verantwortungsdiffusion aufzusitzen, ist es deutlich erfreulicher, die eigene Wirksamkeit sinnvoll weiterzuentwickeln und auszuweiten. Ein sympathisches Vorgehen, das zudem einen gewissen Schutz davor bietet, zu verhärmen.
Ihr individueller Einsatz für die Energiewende gewinnt an Gewicht, wenn Sie Teil einer aktiven Gemeinschaft werden. Energiegenossenschaften, regionale Initiativen oder die (übrigens weiterhin aktive) For-Future-Bewegung bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich mit anderen zusammenzutun und Verantwortung zu übernehmen. Psychologisch steigert das auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrem Handeln Freude erleben, es verbessert das Durchhaltevermögen und vergrößert Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Realistische Handlungsspielräume ergeben sich etwa kommunal bei der Ausweisung von Flächen für Windkraft, bei Wärmenetzen oder dem Etablieren innovativer Mobilitätskonzepte. Wer sich hier einbringt, nutzt einen realistischen und wohnortnahen Handlungsspielraum und kann mit etwas Glück und Geschick in absehbarer Zeit konkrete Ergebnisse hervorbringen. Auch Teilerfolge und Lernerfahrungen sind ein hilfreicher Teil dieses Prozesses.
»Durch Ihr Handeln verändern Sie aktiv das, was andere als Normalität wahrnehmen«
Falls Sie bei Ihrem Engagement auf Widerstände stoßen –, sei es durch Skepsis im Bekanntenkreis, Gegenwind in politischen Debatten oder Ähnliches – machen Sie sich klar: Die Veränderungen, die wir als Gesellschaft durchleben, sind riesig. Das kann Angst erzeugen, etwa vor den Kosten, vor Arbeitsplatz- oder Wohlstandsverlust, oder schlicht davor, »abgehängt « zu werden. Endlose Grundsatzdiskussionen helfen da meist weniger als konkrete Unterstützung, eine wiederholte Einladung zum Mitmachen und das eigene gute Vorbild.
53 Prozent der Befragten erklärten in einer Umfrage vom Juni, die Klimakrise belaste sie psychisch
Aus der Sozialpsychologie ist bekannt, dass unsere innere Haltung und Alltagsentscheidungen auf unser Umfeld wirken. Die meisten von uns fallen nicht gern auf und orientieren sich am Verhalten anderer. Sichtbares Engagement, sei es durch Investitionen, Verhaltensanpassung oder jede Form der Partizipation, hat somit eine wichtige Vorbildfunktion. Durch Ihr Handeln verändern Sie aktiv das, was andere als Normalität wahrnehmen – und so wird dieses Verhalten dann auch eher als sinnvoll und machbar verstanden.
Die Energiewende ist unbenommen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch politische Weichenstellungen erfordert. Doch damit diese Entscheidungen erfolgen können, braucht es das individuelle und kollektive Handeln von allen Menschen, die das Problem verstanden haben.